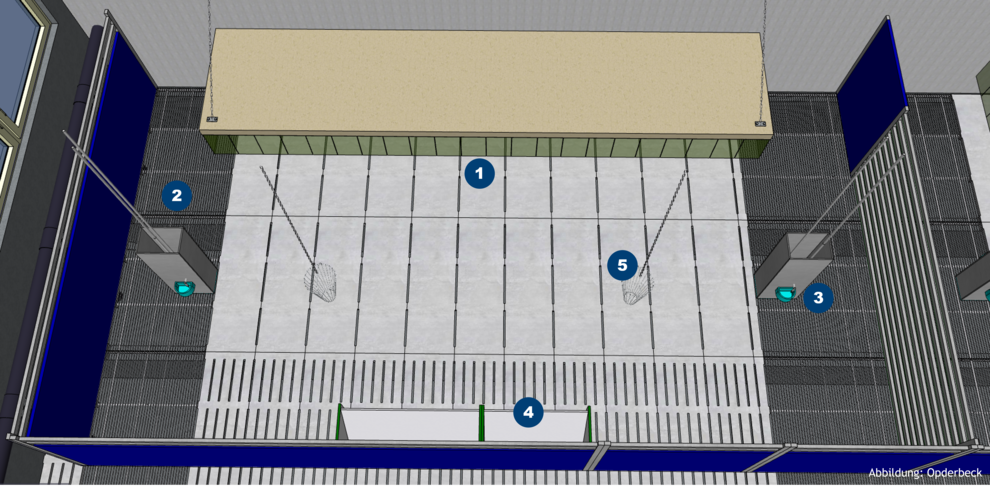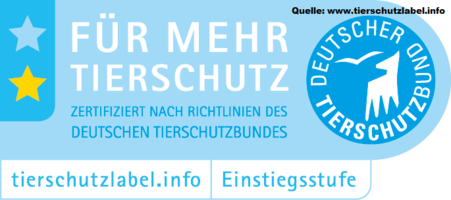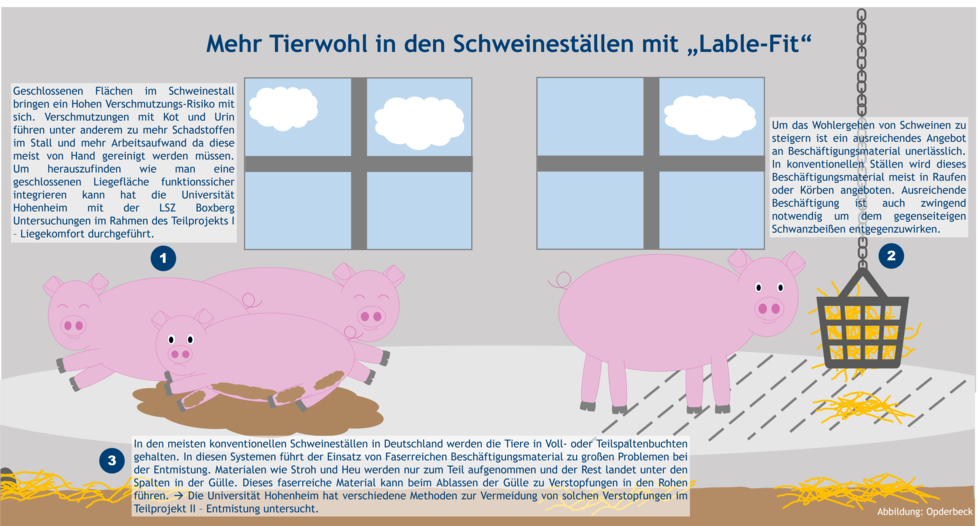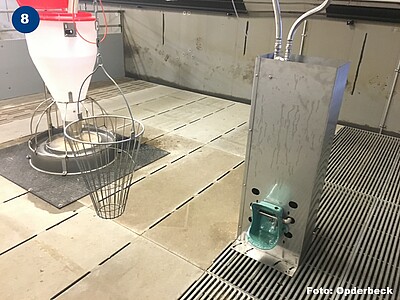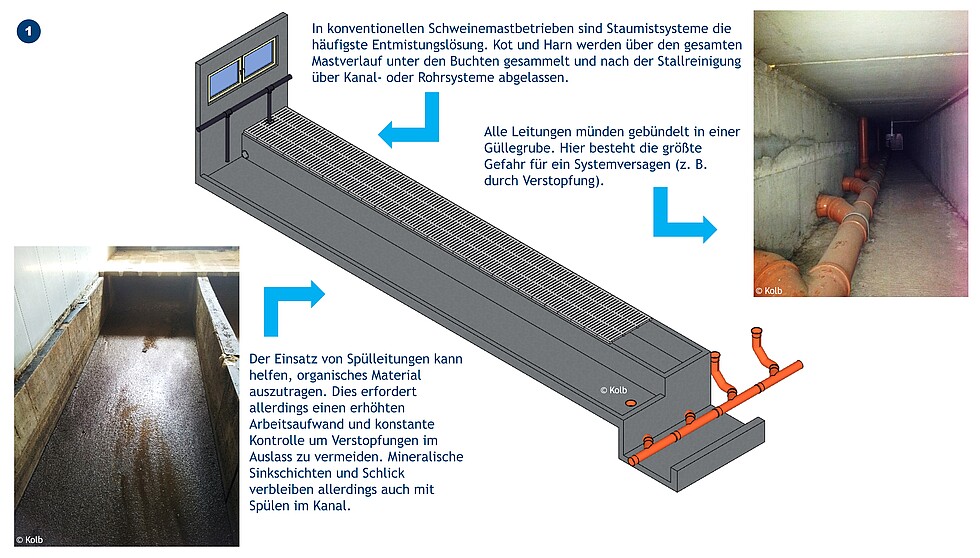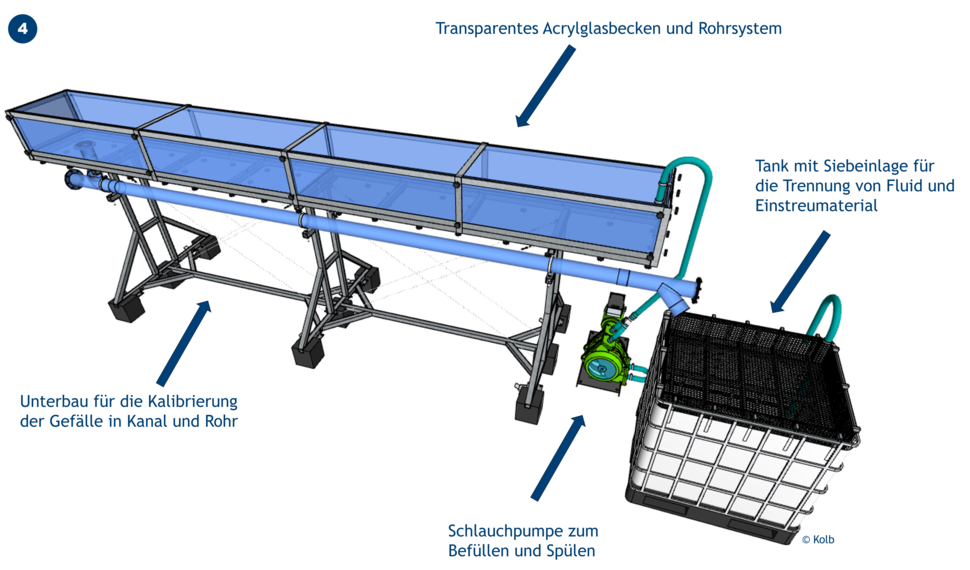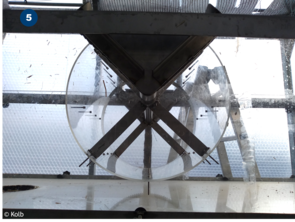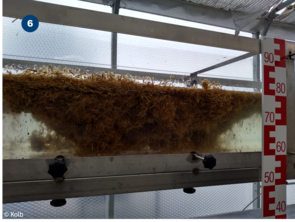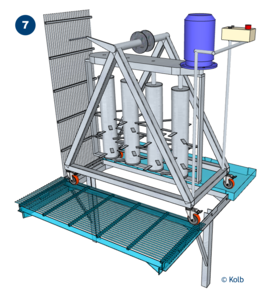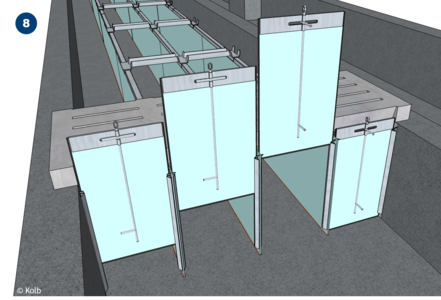In der LSZ Boxberg wurden vier Mast- und zwei Aufzuchtabteile umgebaut und über mehrere Durchgänge wurden Daten erhoben und ausgewertet. Es wurde das Verhalten der Tiere beobachtet sowie Tierwohlindikatoren und Stallklimadaten erhoben.
Ziel des Teilprojekts I - Liegekomfort:
In diesem Projekt wurde untersucht wie durch die Gestaltung des Liege- und Eliminationsbereiches eine zielgerichtete Nutzung durch die Tiere entsprechend der Funktion sichergestellt werden kann.
Untersuchte Ansätze:
• Buchtenstruktur (Anordnung Liegefläche und Fütterung)
• Vergleich perforierter Flächen (Betonspalten vs. Dreikant)
• Gruppengröße
• Heizen/Kühlen des Bodens
• Abdeckung über Liegefläche
• Hohe Lichtintensität im Spaltenbereich